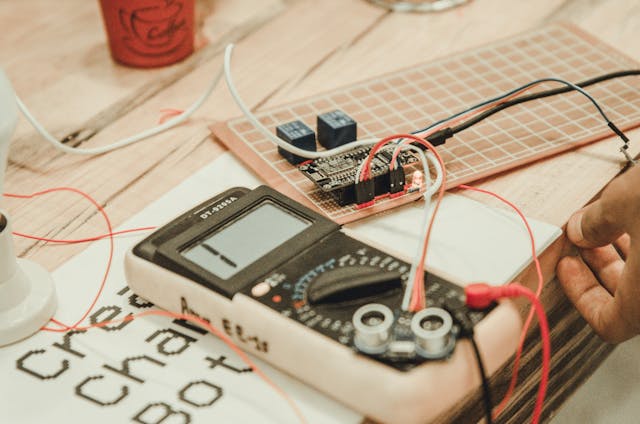Wie sich das internationale Umfeld in der ersten Jahreshälfte verändert hat

Adam Nir, Unsplash
In der ersten Hälfte des Jahres 2025 sah die Weltwirtschaftslage unbeständig aus. Die USA und die Eurozone bewegten sich in unterschiedlichen Rhythmen, und der allgemeine Hintergrund wurde weniger von internen als von externen Faktoren bestimmt - vor allem von den drohenden Zollerhöhungen aus Washington. Auf den ersten Blick deuten die BIP-Zahlen auf ein moderates Wachstum hin: Die Eurozone legte im zweiten Quartal nur 0,1 Prozent zu, während die USA nach einem Einbruch zu Jahresbeginn um 0,7 Prozent zulegten. Ein genauerer Blick zeigt jedoch, dass sich hinter diesen Zahlen starke Schwankungen bei den Importen und Exporten in Erwartung von Handelsschranken verbergen.
So wurde ein Großteil des Wachstums der Eurozone im ersten Quartal ausschließlich von Irland getragen, wo das BIP aufgrund der Tätigkeit multinationaler Unternehmen stark anstieg. Im zweiten Quartal, als sich die Lage stabilisierte, verlangsamte sich die Wirtschaft des Euroraums drastisch. Deutschland, ein wichtiger Exporteur im Allgemeinen, schrumpfte um -0,1 Prozent, was auf einen Rückgang der Exportaufträge zurückzuführen ist.
Die USA ihrerseits haben ihre Importe zu Beginn des Jahres erhöht und dann zurückgefahren - und das hat ihr BIP-Wachstum im zweiten Quartal angekurbelt. Aber im Wesentlichen versuchen beide Regionen proaktiv, die Auswirkungen der erwarteten Verschlechterung der Handelsbedingungen zu minimieren. Die Inlandsnachfrage in den USA, einschließlich der Investitionen und des Verbrauchs, zeigt deutliche Anzeichen einer Verlangsamung. Auch auf dem Arbeitsmarkt verschlechtert sich die Lage: Die Revision der Frühjahrsdaten ergab eine deutlich niedrigere Rate der Arbeitsplatzschaffung, was den Direktor des Bureau of Labour Statistics seinen Job kostete.
Vor diesem Hintergrund bleibt das Vertrauen der Unternehmen schwach. In den USA verschlechtert sich die Stimmung in der Industrie und im Dienstleistungssektor, während der Index für den Dienstleistungssektor in der Eurozone seit mehreren Monaten stetig steigt. Das Verbrauchervertrauen ist in beiden Volkswirtschaften verhalten, in der Eurozone erholt es sich jedoch nur langsam - mit starken Unterschieden zwischen den Ländern: In Deutschland ist ein deutlicher Aufschwung zu verzeichnen, während sich die Stimmung in Frankreich eher verschlechtert.
Der Automobilmarkt in Europa bleibt unter Druck. Die Neuwagenverkäufe in der Eurozone sind im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 % zurückgegangen, wobei Frankreich (-8 %), Belgien (-11 %) und Deutschland (-5 %) besonders betroffen waren. Eine seltene Ausnahme bildet Spanien, wo die Verkäufe um 14 % stiegen. Luxemburg verzeichnete ebenfalls ein schwaches, aber positives Ergebnis: +1% nach einem Rückgang im Jahr 2024. Dennoch liegt der Umsatz immer noch deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie: um 15% in Luxemburg und um 20% im Durchschnitt der Eurozone.
Ein interessanter Trend war der Anstieg der Hypothekarkredite in Luxemburg im zweiten Quartal. Die Zahl der neuen Darlehen stieg im Jahresvergleich um 33 %, was auf niedrigere Zinsen, gelockerte Bedingungen und staatliche Subventionen zurückzuführen ist. Der Aufschwung war vor allem im Segment der variabel verzinslichen Darlehen zu spüren - diese stiegen um fast 50 % und machen nun fast die Hälfte aller neuen Darlehen aus. Dies ist die erste derartige Veränderung seit drei Jahren. Der durchschnittliche variable Zinssatz lag im Juni sogar unter dem festen Zinssatz, und es wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt.
Grüne Fonds spielen auf dem luxemburgischen Finanzmarkt weiterhin eine wichtige Rolle. Zur Jahresmitte machten Fonds, die ökologische oder soziale Faktoren berücksichtigen (so genannte Artikel 8-Fonds), 61 Prozent des Gesamtvermögens aus. Fonds mit einem klar definierten nachhaltigen Zweck (Artikel 9-Fonds) sind mit nur 3 Prozent weiterhin weniger stark vertreten. Das wachsende Interesse an nachhaltigen Anlagen wird jedoch von Kontroversen begleitet: Seit 2022 hat sich der Anteil der Artikel-8-Fonds an den Verteidigungsinvestitionen vervierfacht. Und während die Artikel-8-Fonds neues Kapital anziehen, verlieren die strengeren Artikel-9-Fonds weiterhin Geld - im siebten Quartal in Folge.
Der Bausektor erholt sich langsam. Die allgemeine Stimmung der Unternehmen hat sich verbessert, vor allem im Hochbau, auch wenn die Facharbeiten weiterhin stagnieren. Die Unternehmen klagen zwar immer noch über mangelnde Nachfrage, aber der Anteil dieser Klagen ist rückläufig. Dies geht einher mit einem moderaten Beschäftigungswachstum in der Branche. In der Industrie stieg die Zahl der Arbeitsplätze im zweiten Quartal leicht an, nachdem sie zu Beginn des Jahres zurückgegangen war. Dazu trugen vor allem die Nahrungsmittelindustrie, die Metallurgie und der Energiesektor bei. Im Baugewerbe werden weiterhin Arbeitsplätze abgebaut, allerdings verlangsamt sich das Tempo.
Die Inflation in Luxemburg hat sich im zweiten Quartal leicht beschleunigt - auf 2,1% im Jahresvergleich. Dies ist u.a. auf die automatische Indexierung der Löhne zurückzuführen. Es wird jedoch prognostiziert, dass sie bis 2026 auf 1,4 % sinken wird, dank sinkender Energiepreise und staatlicher Maßnahmen zur Senkung der Stromtarife (um 9 %). Die Preise für Dienstleistungen und Lebensmittel werden dagegen weiter steigen, allerdings nur moderat. Die nächste Lohnindexierung ist für das dritte Quartal 2026 vorgesehen.
Vor diesem Hintergrund war eine wichtige Entwicklung das neue Handelsabkommen zwischen der EU und den USA, das einen einheitlichen Höchstzollsatz von 15 % auf europäische Waren vorsieht. Dies beseitigt einen Großteil der inflationsbedingten Unsicherheit, die durch gegenseitige Zölle entstanden wäre. Darüber hinaus hat Europa erklärt, dass es bis 2028 jährlich Energie im Wert von 250 Milliarden Dollar aus den USA importieren will - dreimal so viel wie im Jahr 2024. Bislang geht das Wachstum auf Kosten von Flüssiggas, dessen Importe in sechs Monaten um 60 Prozent gestiegen sind. Langfristig scheinen solche Mengen jedoch nur schwer zu erreichen zu sein, insbesondere bei Öl.
Die luxemburgische Wirtschaft bewegt sich, wie Europa insgesamt, mit Blick auf die globalen Turbulenzen. Die Länder versuchen, sich auf die instabile US-Handelspolitik einzustellen, und die Binnenmärkte - von Immobilien bis zum Arbeitsmarkt - zeigen vorsichtige Anzeichen einer Stabilisierung. Solange aber die Abhängigkeit von den äußeren Bedingungen noch groß ist, ist es zu früh, von einer dauerhaften Erholung zu sprechen.