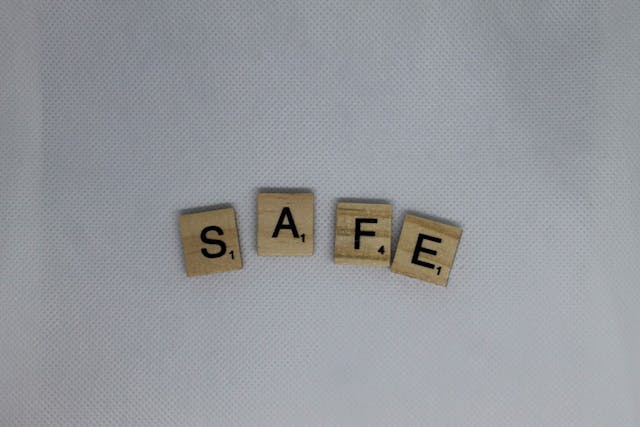Luxemburg weist das niedrigste Niveau der Überqualifizierung in der EU auf

Giulia Squillace, Unsplash
Laut Eurostat hat Luxemburg im Jahr 2024 den niedrigsten Anteil an "überqualifizierten" Arbeitnehmern in der Europäischen Union: nur 4,7 Prozent der Arbeitnehmer haben eine Ausbildung, die über die Anforderungen ihrer Position hinausgeht. Dies steht in starkem Kontrast zum EU-Durchschnitt von 21,5 Prozent und insbesondere zu Ländern wie Spanien und Griechenland, wo jeder dritte Arbeitnehmer in einer Position arbeitet, die nicht seinem Bildungsniveau entspricht.
Dieses Phänomen, das als Überqualifizierung bezeichnet wird, deutet häufig auf ein Ungleichgewicht zwischen dem Bildungssystem und dem Arbeitsmarkt hin. In Luxemburg hingegen besteht ein Gleichgewicht zwischen den Diplomen und der Arbeitsrealität, was auf einen hohen Grad an Präzision bei der Einstellung und eine Wirtschaftsstruktur hinweist, die in der Lage ist, qualifizierte Personen effizient zu absorbieren.
Der Grad der Überqualifizierung in Luxemburg weist nur minimale Unterschiede zwischen den Geschlechtern und dem Alter auf: 5,1 Prozent bei den Frauen und 4,3 Prozent bei den Männern. Bei den jungen Menschen (25-34 Jahre) ist die Quote mit 3,7 % sogar noch niedriger, während die älteren Kategorien (35+) eine etwas höhere Quote von 4,6 % aufweisen. Dies könnte sowohl auf eine genauere Profilierung in den neuen Bildungsprogrammen als auch auf eine bessere Arbeitsplanung in den neuen Generationen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt die Erwerbstätigenquote der Personen im erwerbsfähigen Alter in Luxemburg bei 74,2 %, das sind 0,4 Prozentpunkte weniger als im Jahr zuvor. Dies ist etwas niedriger als der EU-Durchschnitt (75,8 %), aber deutlich höher als zum Beispiel in Belgien (72,3 %).
Die Haupttriebkraft des Beschäftigungswachstums in den letzten 15 Jahren war die Aktivierung von Frauen: Während 2009 nur 61,5 % der Frauen beschäftigt waren, werden es 2024 71,4 % sein. Im Gegensatz dazu sank die Beschäftigungsquote der Männer im gleichen Zeitraum von 79 Prozent auf 76,9 Prozent, was jedoch dem europäischen Trend entspricht.
Dieser Wandel spiegelt tiefgreifende Veränderungen in der Struktur der Gesellschaft und des Arbeitsmarktes wider: flexible Beschäftigungsformen, ein wachsender Anteil des Dienstleistungssektors und verbesserte Bedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie tragen zur Integration der Frauen in die Wirtschaft bei.
Ein vergleichender Blick auf die EU ergibt ein interessantes Bild: Die höchste Frauenerwerbstätigkeit ist in Estland (80,9 %) und Schweden (79,9 %) zu verzeichnen, was bei Ländern mit starker sozialer Unterstützung und Gleichstellungspolitik nicht überrascht. Am anderen Ende der Skala liegen Italien (57,4 %) und Griechenland (59,9 %), wo das traditionelle Familienmodell noch immer vorherrscht.