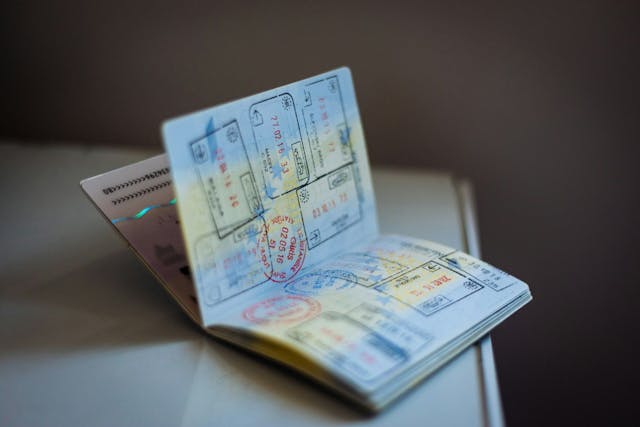Januar 2025 war der wärmste Januar seit Beginn der Aufzeichnungen

Raimond Klavins, Unsplash
Nach Angaben des Copernicus Climate Change Service (C3S) war der Januar 2025 der wärmste Januar auf globaler Ebene. Die durchschnittliche Oberflächentemperatur erreichte 13,23 °C, 0,79 °C über dem Durchschnitt von 1991-2020 und 1,75 °C über dem vorindustriellen Niveau (1850-1900).
Der Januar war auch der 18. Monat in den letzten 19, in dem die Temperaturen um 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau lagen, was bestätigt, dass sich die globale Erwärmung beschleunigt.
Die Temperatur in Europa lag im Januar 2025 bei 1,80°C, 2,51°C über der Klimanorm. Dies ist der zweitwärmste Januar in der aufgezeichneten Geschichte nach 2020, als die Anomalie 2,64°C erreichte.
Die höchsten Temperaturen wurden in Süd- und Osteuropa, einschließlich Westrussland, gemessen. Gleichzeitig herrschten in Island, dem Vereinigten Königreich, Irland, Nordfrankreich und Skandinavien unterdurchschnittliche Temperaturen.
Außerhalb Europas wurden Rekordtemperaturen in Kanada, Alaska, Sibirien, Südamerika, Afrika und Australien beobachtet. Gleichzeitig wurden in den USA, im Osten Russlands (Tschukotka und Kamtschatka), auf der Arabischen Halbinsel und in Südostasien unterdurchschnittliche Temperaturen beobachtet.
Die mittlere Meeresoberflächentemperatur (SST) lag im Januar 2025 bei 20,78°C und war damit die zweithöchste, die jemals für einen Januar gemessen wurde. Obwohl die Temperaturen im zentralen äquatorialen Pazifik unter der Norm lagen, blieben sie im östlichen Teil über dem Durchschnitt, was auf eine Verlangsamung des Übergangs zum La-Niña-Phänomen hinweist.
Im Januar 2025 gab es in Westeuropa, Italien, Skandinavien und den baltischen Staaten übermäßige Niederschläge, die zu Überschwemmungen führten. Der Norden des Vereinigten Königreichs, Irland, Ostspanien und das nördliche Schwarze Meer litten dagegen unter Niederschlagsdefiziten.
Außerhalb Europas kam es in Alaska, Kanada, Ostrussland, Ostaustralien, Südostafrika und Südbrasilien zu ungewöhnlichen Regenfällen und Überschwemmungen. Gleichzeitig herrschte im Südwesten der Vereinigten Staaten, im Norden Mexikos, in Nordafrika, im Nahen Osten, in Zentralasien, im Osten Chinas und in weiten Teilen Südamerikas und Australiens Trockenheit.
Das arktische Meereis erreichte im Januar 2025 den niedrigsten jemals gemessenen Wert, den zweitniedrigsten nach dem Januar 2018. Die Eisbedeckung lag 6 Prozent unter dem Durchschnitt. Besonders stark war der Rückgang im östlichen Kanada (einschließlich der Hudson Bay und der Labradorsee) und in der nördlichen Barentssee.
In der Antarktis blieb die Eisbedeckung ebenfalls unter dem Normalwert (um 5 %), lag aber näher an den Durchschnittswerten als in den Jahren 2023-2024, als Rekordtiefs beobachtet wurden.
Die Klimatrends brechen weiterhin neue Temperaturrekorde, trotz des Einflusses von La Niña, der normalerweise die globalen Temperaturen senkt. Der Januar 2025 war ein weiteres alarmierendes Signal, das die Beschleunigung der globalen Erwärmung bestätigte. Die Experten von Copernicus beobachten weiterhin die Veränderungen der Meerestemperaturen und ihre Auswirkungen auf das Klima im Jahr 2025.