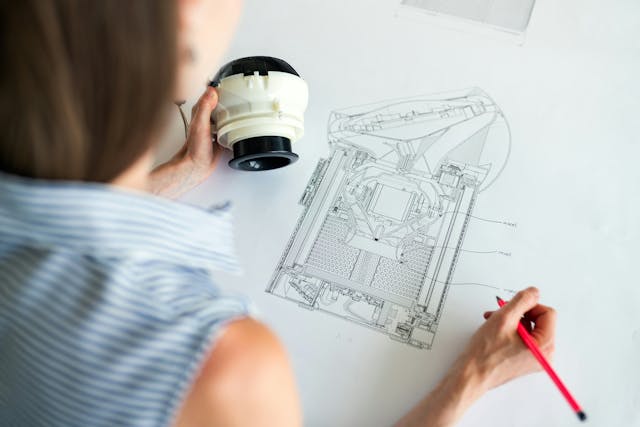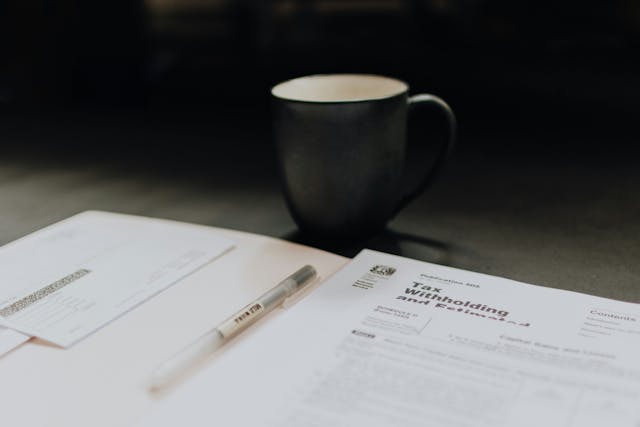Einer von 17 EU-Bürgern fühlt sich bei der Wohnungssuche diskriminiert

Jakub Żerdzicki, Unsplash
Nach den Eurostat-Daten für 2024 gaben 5,9 % der EU-Bürger ab 16 Jahren an, sich bei der Wohnungssuche diskriminiert zu fühlen. Dies ist das höchste Diskriminierungsniveau unter allen untersuchten Lebensbereichen - höher als bei der Interaktion mit Behörden (5,2 %), an öffentlichen Orten (3,4 %) und im Bildungssystem (2,6 %).
Besonders akut ist das Problem für Menschen, die am Rande der Armut oder der sozialen Ausgrenzung stehen (AROPE). Von ihnen fühlten sich 10,1 Prozent bei der Wohnungssuche diskriminiert, während es bei den Bessergestellten nur 4,7 Prozent waren. Ähnliche Unterschiede sind in anderen Bereichen zu verzeichnen: bei der Inanspruchnahme öffentlicher Dienstleistungen (9,2 Prozent gegenüber 4,2 Prozent), im öffentlichen Raum (5,7 Prozent gegenüber 2,8 Prozent) und im Bildungswesen (4,4 Prozent gegenüber 2,1 Prozent).
Es ist wichtig anzumerken, dass es sich dabei um selbst empfundene Diskriminierung handelt, die auf den subjektiven Gefühlen der Menschen beruht. Solche Daten werden zu allen durch EU-Recht geschützten Gründen erhoben - Geschlecht, Alter, Behinderung, Religion, ethnische oder rassische Herkunft, sexuelle Ausrichtung. Auch wenn die Wahrnehmungen von Land zu Land unterschiedlich sein können, dienen sie als Indikator für versteckte strukturelle Barrieren, die in den offiziellen Statistiken möglicherweise nicht erwähnt werden.
Die Daten werfen die Frage nach informellen Ausgrenzungsmechanismen auf, mit denen gefährdete Gruppen in Europa konfrontiert sind, selbst wenn die Gleichstellung gesetzlich garantiert ist.