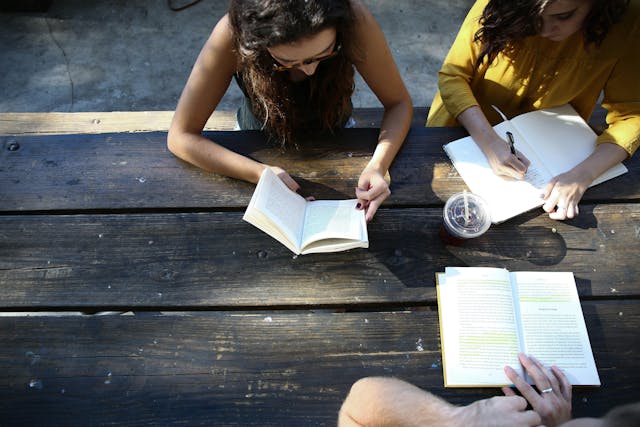Luxemburg bereitet sich auf die Offenlegung der Gehälter gemäß EU-Richtlinie vor

Alicia Christin Gerald, Unsplash
Bis vor kurzem galt es in Luxemburg fast als unanständig, am Arbeitsplatz über Gehälter zu sprechen - eine Art Unternehmensbeichte, die man nicht laut auszusprechen wagte. Die Europäische Union ist da jedoch anderer Meinung. Die neue EU-Richtlinie zur Lohntransparenz ist im Mai 2023 in Kraft getreten, und Luxemburg ist wie die anderen Mitgliedstaaten verpflichtet, die nationale Gesetzgebung bis zum 7. Juni 2026 anzugleichen.
Nach Ansicht von Experten und Behörden ist die Richtlinie nicht nur eine bürokratische Maßnahme, sondern der Versuch einer tiefgreifenden Umgestaltung des Arbeitsmarktes. Ihr zentrales Ziel ist es, die systemische Geschlechterdiskriminierung zu beenden, indem die Lohnpolitik der Unternehmen transparenter und verantwortlicher gemacht wird.
Arbeitnehmer können nun von ihren Arbeitgebern schriftlich Informationen über ihr Gehalt und das Durchschnittsgehalt von Arbeitnehmern in einer ähnlichen Position, aufgeschlüsselt nach Geschlecht, verlangen. Darüber hinaus bedeutet "ähnlich" nicht nur die gleiche Stellenbezeichnung, sondern auch einen ähnlichen Wert der geleisteten Arbeit - in Bezug auf Aufwand, Kompetenzen und Verantwortungsniveau.
Auch die Einstellungsvorschriften werden sich ändern: Die Unternehmen werden verpflichtet sein, den Bewerbern ein Anfangsgehalt oder eine Gehaltsspanne zu nennen, die auf objektiven und geschlechtsneutralen Kriterien beruht. Es wird verboten sein, die Bewerber nach ihrem aktuellen oder früheren Einkommen zu fragen, ein Mechanismus, der oft dazu benutzt wurde, die Gehaltsvorstellungen, insbesondere von Frauen, zu "drücken".
Doch die eigentliche Sorge der Arbeitgeber ist nicht dies, sondern das obligatorische Berichtssystem. Ab 2027 müssen große Unternehmen (mehr als 250 Beschäftigte) jährliche Gehaltsberichte übermitteln, aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Berechnungsmethode. Unternehmen mit 100 bis 249 Beschäftigten - ab 2031 alle drei Jahre. Wenn das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen mehr als 5 Prozent beträgt und nicht durch objektive Gründe (wie Qualifikation, Dienstalter oder Produktivität) gerechtfertigt werden kann, müssen die Arbeitgeber es beseitigen. Unternehmen mit bis zu 100 Beschäftigten können nach Belieben Bericht erstatten - ohne Verpflichtung zur Beseitigung der Ungleichheit.
Besonderes Augenmerk wird in der Richtlinie auf das Beweisverfahren gelegt. Bisher musste der Arbeitnehmer die Lohndiskriminierung selbst nachweisen. Jetzt ist es umgekehrt: Wenn ein Arbeitnehmer eine Beschwerde einreicht, muss der Arbeitgeber beweisen, dass alles im Einklang mit dem Gesetz war. Dies stärkt die Position der Arbeitnehmer in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten erheblich.
Die Umsetzung der Richtlinie wird jedoch nicht unproblematisch sein. Das luxemburgische Arbeitsministerium räumt ein, dass die Verzögerung des Gesetzesentwurfs durch die Notwendigkeit verursacht wurde, die Position mehrerer Ministerien gleichzeitig zu koordinieren. Die Behörden befürchten, dass ein übermäßiger Verwaltungsdruck, insbesondere auf kleine und mittlere Unternehmen, das Gegenteil bewirken wird: geringere Motivation, verstärkter interner Wettbewerb und Schwierigkeiten beim Schutz personenbezogener Daten. Dennoch versprechen sie, den Gesetzesentwurf bis Ende 2025 vorzulegen.
Gleichzeitig kann die Richtlinie ein wirksamer Hebel sein, um "unsichtbare Barrieren" bei der beruflichen Entwicklung und der Entlohnung zu bekämpfen. Luxemburg, wo Frauen im Durchschnitt 4,7 Prozent weniger verdienen als Männer (laut Eurostat-Daten für 2023), ist nicht in der schlechtesten, aber auch nicht in einer vorbildlichen Position.